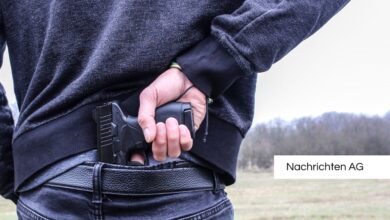In der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs entwickelte das nationalsozialistische Regime eine systematische Strategie zur Konzentrierung von Kulturgütern in der sogenannten „Alpenfestung“. Laut uni-heidelberg.de sollten diese Kunstschätze als Faustpfand für bevorstehende Friedensverhandlungen mit den Alliierten dienen. Prof. Kerstin von Lingen, eine Expertin für Zeitgeschichte an der Universität Wien, beleuchtet in einem Vortrag die methodischen Ansätze des organisierten Kunstraubs, den NS-Dienststellen in dieser letzten Kriegsphase verfolgten.
In ihrem Vortrag nennt von Lingen beispielhaft zwei bedeutende Fälle. Zum einen wurden wertvolle Kunstschätze aus den „Uffizien“ im Südtiroler Passeiertal geraubt. Zum anderen befanden sich Kulturgüter aus dem geraubten jüdischen Umzugsgut im Freihafen von Triest. Das Thema der Sühne für den nationalsozialistischen Kunstraub wird im Kontext der alliierten Nachkriegsjustiz vertieft behandelt.
Einblicke in die Aufarbeitung der Kunstraubgeschichte
Die Ruperto Carola Ringvorlesung an der Universität Heidelberg, die den Titel „1945: Epochenschwelle und Erfahrungsraum“ trägt, beleuchtet das Kriegsende in Europa vor 80 Jahren. Diese Reihe von Vorträgen wurde von Prof. Dr. Manfred Berg konzipiert und zielt darauf ab, gesellschaftlich relevante Forschungsfragen einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Interessierte können Aufzeichnungen der neun Vorträge auf heiONLINE, dem zentralen Portal der Universität Heidelberg, einsehen.
Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf Kunst- und Kulturgüter in Deutschland sind tiefgreifend. Die staatliche Raubkunststrategie des nationalsozialistischen Regimes, die von 1933 bis 1945 betrieben wurde, führte zu einem massiven Verlust an kulturellen Schätzen. Laut ardkultur.de sind Begriffe wie „NS-Raubkunst“, „Entartete Kunst“ und „Beutekunst“ zentral für die Diskussion rund um diese Themen.
NS-Raubkunst bezeichnet den rechtswidrigen Entzug von Privateigentum, der besonders jüdische Eigentümer betroffen hat. Diese Verfolgung führte nicht nur zu erzwungenen Verkäufen, sondern auch zu staatlichen Beschlagnahmungen ohne jede Entschädigung. Die Aktion „Entartete Kunst“, die in den 1930er Jahren gestartet wurde, zielte auf Kunstwerke ab, die den nationalsozialistischen Idealen nicht entsprachen, was zur Beschlagnahmung und Vernichtung vieler Werke führte.
Restitutionsbemühungen und kulturelles Erbe
Die Erwähnung des Kunstsammlers Hans Fürstenberg verdeutlicht die personalisierte Dimension des Kunstraubs. Der Direktor der Berliner Handelsgesellschaft sammelte wertvolle Bücher und Kunst, darunter die Bronzeplastik „Ruhende Frau“, die von Fritz Huf in den 1920er Jahren geschaffen wurde. Nach 1933 musste Fürstenberg als Jude große Teile seines Vermögens abgeben und floh mit seiner Frau ins Ausland. Nach dem Krieg wurde seine Skulptur im Garten von Schloß Schönhausen, dem Dienstsitz von Wilhelm Pieck, entdeckt. Im Jahr 2022 wurde die Statue nach einer detaillierten Spurensuche restituiert und zurückgekauft. Sie ist heute im Schloß Schönhausen zu sehen.
Die Rückgabe und Entschädigung unrechtmäßig entzogener Kunstwerke sind komplexe Themen. bpb.de berichtet, dass nach dem Zweiten Weltkrieg über 2,6 Millionen Kunstwerke und mehr als sechs Millionen Bücher von der Roten Armee beschlagnahmt wurden. In Deutschland sind bis heute viele Kunst- und Kulturgüter aus jüdischem Eigentum in Museen und Bibliotheken vorhanden.
Die gesetzliche Regelung zur Rückgabe von entzogenem Eigentum erfolgte nach 1945 durch die West-Alliierten und die Bundesrepublik Deutschland. Im Gegensatz dazu hatte die DDR keine Vergleichsregelungen. Die „Washingtoner Prinzipien“ von 1998 fordern eine Identifizierung beschlagnahmter Kunstwerke und die Einrichtung eines zentralen Registers. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat seither zahlreiche Restitutionsanträge bearbeitet.
Die deutsch-russischen Verhandlungen über Kunst- und Kulturgüter stagnieren seit 1995, und viele Ansprüche erscheinen schwer durchsetzbar. Der politische Wandel in Europa bleibt entscheidend für zukünftige Lösungen, die eine Klärung der Provenienz und den Zugang zu den betroffenen Kunst- und Kulturgütern voraussetzen.