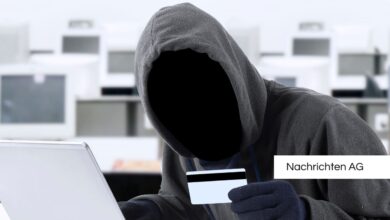Am 25. Juli 2025 hat das Hessische Wissenschaftsministerium bedeutende Schritte zur Förderung der Antisemitismusforschung und der Demokratieforschung vorgestellt. Im Rahmen des Programms „Stärkung der Demokratieforschung Hessen“ sollen gezielte Forschungsprojekte an Hochschulen unterstützt werden, um Demokratie widerstandsfähiger gegen Extremismus und Polarisierung zu machen. Demnach sollen insgesamt über 269.000 Euro in die vielversprechendsten Konzepte fließen, die von einem externen Gutachtergremium ausgewählt wurden, wie Uni Gießen berichtet.
Die geförderten Hochschulen umfassen die Justus-Liebig-Universität Gießen, die Hochschule RheinMain, die Hochschule Darmstadt, die Frankfurt University of Applied Sciences sowie die TU Darmstadt. Wissenschaftsminister Timon Gremmels betont die erhebliche Rolle der Wissenschaft im Kampf gegen Antisemitismus und hebt hervor, dass die Projekte oft Partner aus der Praxis einbinden, was ihr Transferpotenzial erhöht.
Langfristige Förderpläne und spezifische Projekte
Für die Antisemitismusforschung sind bis 2028 mehr als 1.902.000 Euro eingeplant. Zudem wird die Förderlinie „Hessische Evaluation und Begleitung“ mit über 842.000 Euro für Projekte zur Demokratiesicherung bis 2027 unterstützt. Besonders hervorzuheben ist das Projekt „Verankerte Geschichte(n), starke Demokratie“ an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Es untersucht schulische Formate der Erinnerungskultur und hat dabei das Ziel, Best-Practice-Beispiele zu identifizieren, den schulübergreifenden Austausch zu fördern und entsprechende Handlungsempfehlungen zu entwickeln.
Der Forschungsbereich im Demokratiezentrum der Universität Marburg befasst sich intensiv mit der Studie von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Hessen. Es wird analysiert, unter welchen Bedingungen diese Phänomene entstehen und welche Auswirkungen sie auf die Gesellschaft haben. Die Forschung zielt darauf ab, spezifische lokale und regionale Bedingungen zu erfassen sowie die Folgen und Bewältigungsstrategien von rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt zu untersuchen, wie Uni Marburg ergänzt.
Forschungsergebnisse und gesellschaftliche Auswirkungen
Ein zentraler Aspekt der Forschung ist die Analyse von Ermöglichungs- oder Verhinderungsräumen für demokratiefeindliche Einstellungen. Diese Erkenntnisse sollen nicht nur der Wissenschaft zugutekommen, sondern auch zur Weiterentwicklung von Beratungs- und Bildungsformaten dienen. Der interdisziplinäre Ansatz verbindet theoretische Grundlagen mit praktischer Begleitforschung und bezieht historische sowie aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen in die Analysen ein.
Insgesamt ermöglicht die Förderung eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus und der Stärkung der Demokratie. Die Projekte versprechen nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch praxisnahe Lösungsansätze und Maßnahmen zur Bekämpfung von Extremismus und zur Förderung eines respektvollen Miteinanders, wie das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst berichtet (Hessen.de).