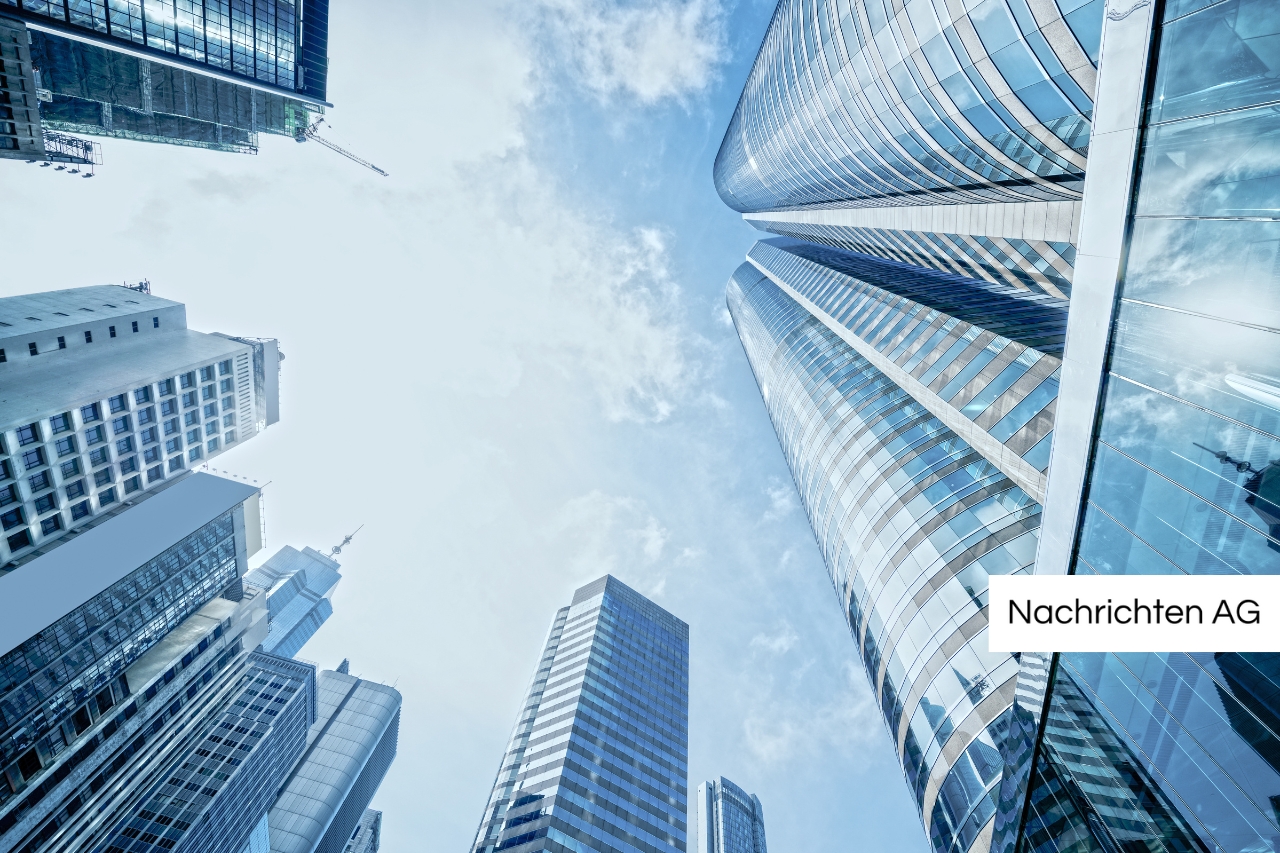
Eine aktuelle Untersuchung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz in Deutschland zeigt signifikante Entwicklungen und Herausforderungen. Die zweite Konstanzer KI-Studie 2025, durchgeführt von der Universität Konstanz, hat ergeben, dass der Anteil der Beschäftigten, die KI nutzen, um 11 Prozentpunkte gestiegen ist und nun bei 35 Prozent liegt. Dabei sind insbesondere Anwendungen zur automatisierten Textgenerierung, wie etwa ChatGPT, besonders beliebt. Trotz der steigenden Nutzung gibt es Unsicherheiten: Ein Drittel der Beschäftigten kann nicht einschätzen, wie sich KI auf ihre Arbeit auswirken wird.
Die Studie verdeutlicht zudem die Wahrnehmung von Risiken. 46 Prozent der Befragten sehen gravierende Risiken für den gesamten Arbeitsmarkt durch die Automatisierung. Dennoch fürchten nur 20 Prozent einen persönlichen Arbeitsplatzverlust. In wissensintensiven Berufen wie IT, Verwaltung und Forschung liegt der KI-Einsatz bereits bei 45 Prozent, während in produktionsnahen und handwerklichen Berufen lediglich 21 Prozent der Beschäftigten von KI profitieren. Dies stellt einen Zuwachs von 15 Prozentpunkten bzw. 4 Prozentpunkten dar, was die wachsende Kluft zwischen verschiedenen Berufsfeldern unterstreicht.
Wachsende digitale Kluft
Die fragliche Entwicklung wirft ein Licht auf die Anfälligkeit für eine digitale Spaltung des Arbeitsmarkts. Laut der Studie nutzen Beschäftigte mit einem abgeschlossenen Studium KI dreimal so häufig wie Personen mit einem niedrigeren Bildungsabschluss. Dies deutet auf eine wachsende Kluft hin, die ohne gezielte Unterstützung von Politik und Wirtschaft weiter auseinanderdriften könnte. Besonders kleine Unternehmen investieren kaum in Weiterbildungsmaßnahmen im Umgang mit KI – nur 8 Prozent dieser Firmen bieten entsprechende Angebote an. Im Gegensatz dazu sind es ein Drittel der größeren Unternehmen, die ihren Mitarbeitern KI-Schulungen ermöglichen.
Ein weiteres zentrales Ergebnis der Konstanzer KI-Studie ist die steigende Bereitschaft in der Belegschaft, sich im Umgang mit KI weiterzubilden. Vor allem unter höher gebildeten Beschäftigten zeigt sich ein zunehmendes Interesse. Diese Tendenz könnte helfen, die vorhandenen Diskrepanzen zu verringern und eine gleichmäßigere Verteilung der KI-Nutzung zu fördern. Allerdings besteht die Gefahr, dass die sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede weiter zunehmen, wenn nicht gezielt gegengesteuert wird. Unternehmen stehen vor Herausforderungen wie hohen Kosten, fehlendem Personal und geringer Produktivität.
Generelle Wahrnehmung und Unterstützung durch KI
Gemäß der DiWaBe 2.0-Befragung nutzen rund 60 Prozent der Beschäftigten KI-Technologien am Arbeitsplatz. Viele dieser Nutzer erachten KI als hilfreiches und unterstützendes Arbeitsmittel. Es zeigt sich, dass die formelle Einführung von KI in Unternehmen jedoch oft schleppend voranschreitet, was zu einer weit verbreiteten informellen Nutzung führt. Der Grad der KI-Nutzung wird stark von Faktoren wie Bildung, Alter und Berufssegment beeinflusst. Beschäftigte ohne Bildungsabschluss verwenden KI nur sporadisch, während fast 80 Prozent der Hochqualifizierten auf KI zurückgreifen.
Zusammenfassend zeigt sich, dass das Potenzial von KI im Arbeitsumfeld enorm ist. Doch um die anhaltende Ungleichheit zu verhindern und alle Beschäftigten von den Vorteilen der Technologie profitieren zu lassen, sind dringend politische und betriebliche Anstrengungen erforderlich.
Die umfangreiche Datenerhebung der Konstanzer KI-Studie berücksichtigt außerdem vorangegangene Erhebungen und bietet einen tiefen Einblick in die Entwicklung der KI-Nutzung in Deutschland. Die DFG-Exzellenzcluster „The Politics of Inequality“ förderte die Untersuchung, die sich als wichtiges Werkzeug zur Analyse der gesellschaftlichen Herausforderungen im digitalen Zeitalter erweist.
Weitere Informationen zur digitalen Kluft und zu den Herausforderungen bei der Integration von KI am Arbeitsplatz finden sich in den Berichten auf Haufe und BIBB.
