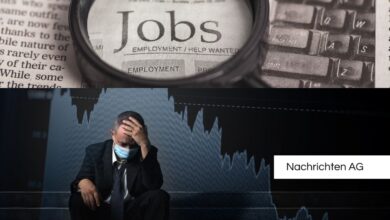Die Herausforderungen von Menschen mit ADHS und Autismus auf dem Arbeitsmarkt stehen im Fokus der Forschung von Psychologin Kerstin Erdal. In ihrer Promotion an der FernUniversität Hagen untersucht sie, wie neurodivergente Personen ihre Potenziale besser entfalten können. Oft wird ADHS und Autismus mit Vorurteilen konfrontiert und als Modekrankheit oder sozial problematisch wahrgenommen. Dabei handelt es sich um Formen der Neurodivergenz; das Gehirn arbeitet anders, nicht defizitär.
In Deutschland sind etwa 1-2% der Erwachsenen autistisch, während 2-3% mit ADHS diagnostiziert sind. Diese Zahlen könnten sogar höher ausfallen, da viele Betroffene keine Diagnose erhalten. Menschen mit ADHS kämpfen häufig mit Lernschwierigkeiten, Unaufmerksamkeit und einem impulsiven Verhalten. Die Realität am Arbeitsmarkt zeigt, dass nur 4 von 10 Personen mit Autismus erwerbstätig sind, während ADHS- Betroffene oft Schwierigkeiten haben, ihre Stellen zu halten. Langzeitarbeitslosigkeit führt häufig zu psychischen Problemen wie Depressionen und Angststörungen.
Die Relevanz eines unterstützenden Arbeitsumfeldes
Eine geeignete Arbeitsstelle kann für neurodivergente Menschen äußerst positive Auswirkungen haben. Kerstin Erdal betont, dass individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen. Arbeitgeber sollten gemeinsam mit den Mitarbeitenden ein passendes Umfeld schaffen, um die Resilienz der Betroffenen zu stärken und ihnen zu helfen, ihre Stellen langfristig zu halten. Dazu gehören Maßnahmen wie ein ruhiges Arbeitsumfeld, unterstützende Technologien, Rückzugsbereiche und klare Anweisungen.
Eine der Herausforderungen am Arbeitsplatz für neurodivergente Personen ist die Stresswahrnehmung. Diese ist intensiver, bedingt durch Unterschiede in der Gehirnverkabelung, insbesondere in der Funktionsweise der Amygdala. Menschen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten in sozialen Situationen und benötigen feste Routinen, um sich wohlzufühlen.
Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis
Ein bemerkenswertes Beispiel für die Integration neurodivergenter Mitarbeitender findet sich in der Zürcher Branding-Agentur Twofold. Unter der Leitung von Marius Deflorin und Noé Robert, beide mit ADHS-Diagnose, verfolgt die Agentur das Ziel, Kreativität durch unterschiedliche Perspektiven zu fördern. Hier werden strukturierte Meetings abgehalten, die lange Smalltalks vermeiden. Dies kommt insbesondere Mitarbeitenden mit Autismus zugute, wie Michael Maurantonio bestätigt.
Die Agentur hat Einzelbüros eingerichtet, um Lärmfaktoren zu minimieren, und erlaubt ihren Mitarbeitenden, Arbeitszeit und -ort flexibel zu gestalten. Trotz vieler positiver Ansätze in individualisierten Arbeitsmodellen berichten Deflorin und Robert von Unternehmen, die nur oberflächliche Änderungen vornehmen, ohne echte Unterstützung für neurodiverse Mitarbeitende zu bieten.
Helene Haker, Fachärztin für Psychiatrie, warnt zudem vor der Verharmlosung von komplexen Krankheitsbildern, die durch die Bezeichnung „neurodivers“ als „Superkraft“ entsteht. Viele Menschen, die auf das Autismus-Spektrum fallen, haben oft nicht die Möglichkeit, ihre Stärken gewinnbringend einzusetzen.
Neurodiversität als Chance für Unternehmen
Der Begriff „Neurodiversität“, geprägt von der Soziologin Judy Singer, beschreibt die neurologische Vielfalt und die Annahme, dass jedes Gehirn unterschiedlich arbeitet. Schätzungsweise gehören 15-20% der Weltbevölkerung zu den neurodiversen Menschen. Diese Vielfalt kann in Teams Wettbewerbsvorteile bringen, wenn die Stärken der einzelnen Personen richtig genutzt werden.
Organisationsberaterin Vera Herzmann hebt hervor, dass Unternehmen sich verändern müssen, um den Bedürfnissen neurodivergenter Mitarbeitender gerecht zu werden. Anpassungen in der Büroumgebung können sensorische Empfindlichkeiten berücksichtigen, und ein unterstützendes Arbeitsumfeld ist entscheidend für das Wohlbefinden. Nur so kann man Diskriminierung am Arbeitsplatz minimieren und den individuellen Stärken Raum geben.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Integration neurodivergenter Mitarbeitender nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit ist, sondern auch ein entscheidender Faktor für Kreativität und Innovationskraft in Unternehmen. Die Voraussetzungen dafür sind allerdings noch in vielen Bereichen zu verbessern.